Priya Basil
Raum. Schaffen oder nehmen?
Zur Politik und Poesie des Raums
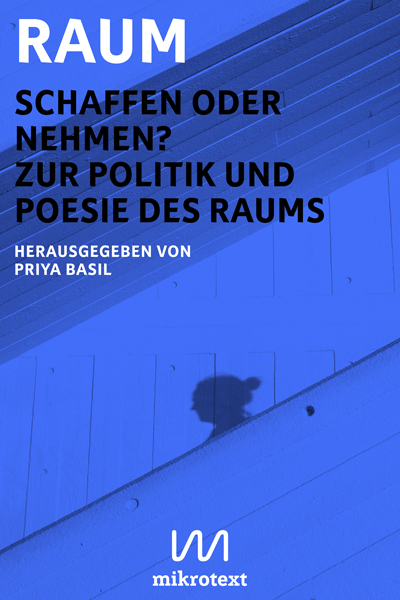
Das Wort Freiraum umschließt ganz unterschiedliche Konzepte, weit mehr als bloß den physischen Raum, es beschreibt auch einen mentalen Zustand der Kreativität und Freiheit. 1929 betonte Virginia Woolf, wie wichtig „ein eigenes Zimmer“ für den Erfolg einer Schriftstellerin sei: Freiraum, im wörtlichen wie übertragenen Sinne, zum Denken und Gestalten. Fast ein Jahrhundert später ist ein eigenes Zimmer noch immer ein Privileg, nicht nur, aber vor allem für Frauen. Ein Virus, das keine Grenzen kennt, hat diese Ungleichheit noch einmal sichtbarer gemacht und damit auch den erbitterten Kampf um Raum und Teilhabe.
3,99 €
Inhalt
Wem gehört der öffentliche Raum, welche Regeln gelten und wie werden sie überwacht? Unausgesprochene Fragen, die weltweit zu einem Erstarken von Gated Communities und andere Formen der sozialen Segregation führen. Wer darf den öffentlichen Raum für sich beanspruchen und definieren? Wessen Regeln bestimmen, wie Raum genutzt und geteilt wird? Wie prägt unsere Identität unsere Raumerfahrung?
Die vier internationalen Autor·innen Billy-Ray Belcourt, Besufekad, Intan Paramaditha und Adania Shibli haben 2021 am digitalen Residenzprogramm des LCB teilgenommen und den Begriff des Raums in Gesprächen und im Schreiben erkundet. Die digitale Residenz wurde von Priya Basil kuratiert und vom Auswärtigen Amt gefördert.
Premiere
13. Dezember 2021, 21 Uhr: Lesungen und Diskussionen mit Billy-Ray Belcourt, Intan Paramaditha and Adania Shibli. Moderation: Priya Basil. In englischer Sprache. LIVESTREAM auf lcb.de.
Mamas Zimmer
Von Intan Paramaditha
Ich erinnere mich, wie das blaue Krankenbett aus Mamas Zimmer ins Wohnzimmer geschoben wird – mit Blick auf den Fernseher, dahinter die eingestaubte Vitrine mit der Keramik und den alten Puppen, schäbig und trostlos. Alles steht dicht gedrängt: das zerkratzte Ledersofa, der Wohnzimmertisch voller Medikamente, Vitamine, Salben und einem Wasserkrug, außerdem ein Klappstuhl neben dem Krankenbett, auf dem für gewöhnlich die Pflegerin sitzt. Nicht weit vom Fußende des Bettes entfernt steht ein runder Esstisch aus Marmor, der in den 80ern modern gewesen war, inzwischen aber seinen Glanz verloren hat. Auf dem Tisch ein Blender, mit dem Kabel an eine Steckdose angeschlossen, oft ungespült für mehrere Stunden.
Nachdem die Pflegerin meiner Mutter die Windeln gewechselt und sie gefüttert hat, setzt sie sich wieder auf den Klappstuhl, wischt sich den Schweiß ab. Dann fächelt sie sich mit einem dünnen Buch in der linken Hand Luft zu, während ihr rechter Daumen auf dem Smartphone hoch- und runterscrollt. Sonntags, wenn sie frei hat, sitze ich dort. Durch das Bett fühlt sich der Raum eng und stickig an, aber Mama möchte nicht in ihrem Zimmer gepflegt werden.
„Ich will nicht allein sein, Muti“, sagt sie.
„Du wirst nicht allein sein“, erwidere ich.
Meine Mutter besteht auf ihrem Platz im Wohnzimmer. Also liegt sie hier, schaut an die Decke, während sie dem Fernseher zuhört. Wenn die Pflegerin damit beschäftigt ist, das Essen zuzubereiten, sitze ich neben meiner Mutter und erledige meine Büroarbeit am Laptop auf meinem Schoß, bis meine Oberschenkel heiß werden.
Mama kommentiert die Nachrichten im Fernsehen. Doch schon bald fordert sie mich auf, die anderen Sender nach einer Seifenoper zu durchsuchen. Wenig später wünscht sie wieder Nachrichten, dann wieder eine Seifenoper, Nachrichten, Seifenoper. Dann flucht sie – wie das bei melodramatischen Serien so ist – und bittet mich schließlich, den Fernseher auszuschalten. Ich bin jedes Mal erleichtert, wenn sie einschläft. Ich betrachte ihre geschlossenen Augen und ihre halb geöffneten trockenen Lippen, dann wende ich mich wieder meinem Bildschirm zu. Nur für einen kurzen Moment. Denn nach zehn Minuten wacht sie wieder auf und bittet mich, ihr aus dem Koran vorzulesen. Ich lese wahllos eine Sure, und sie schließt die Augen. Nach etwa fünfzehn Minuten beginnt meine Stimme sie zu langweilen. Sie bittet mich, eine Aufnahme des Thronverses aus der zweiten Sure des Korans auf YouTube laufen zu lassen. Es ist zu leise, also soll ich es lauter stellen. Wenig später muss ich es wieder leiser machen, lauter, leiser, lauter, ganz aus.
„Alle sind schon gestorben“, sagt sie, „nur ich noch nicht.“
(…)




