Sebastian Christ
Berliner Asphalt
Geschichten von Menschen in Kiezen
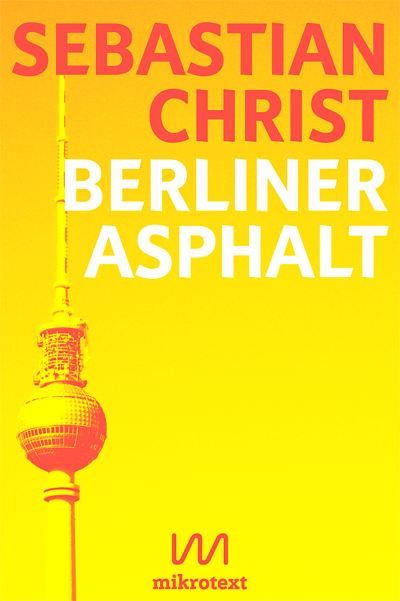
Von Moabit bis Marzahn, vom Reichstag bis zum Rathaus Neukölln, von Potsdam bis zum Tauentzien: Sebastian Christ trifft auf Berlin, meist vom Rad aus. Das Hauptstadt-Buch für persönliche und individuelle Entdeckungen und Radtouren abseits vom Touristenführer. Und für Radelfreudige.
1,99 €
„Großartige, haiku-artige Granulate, die eine Szene oft schon im ersten Satz zusammenfassen.“
Ansgar Warner, ebook-news
Inhalt: Radtour-Geschichten
Berlin ist wohl, neben Paris, die Hauptstadt, der sich die meisten literarischen Spaziergänger und Flaneure verschrieben haben. Von Walter Benjamin über Franz Hessel zu David Wagner inspiriert die sich wandelnde Metropole an der Spree. Nun reiht sich Sebastian Christ, leidenschaftlicher urbaner Radfahrer, in die Berlin-Erzähler ein.
Alles begann auf Facebook. Seine Schreibregel: Mindestens eine Stunde nach dem Erlebnis per Smartphone sollten die Texte veröffentlicht sein. Sie waren kurz, stenographisch und fanden schnell ihre begeisterten Leser in ihrer zufälligen Lakonik. Nie wusste man, in welchen Stadtteil es den Autor das nächste Mal verschlagen würde. Christ hat die Geschichten erweitert und hier und da mit stadtsoziologischen Beobachtungen etwa über den Neubauboom oder den Sicherheitswahn versehen. Auch bisher unveröffentlichte Erlebnisse finden ihren Platz.
Entstanden ist eine Hommage an Berlin am Anfang des 21. Jahrhunderts, insbesondere an ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Und niemals urteilt Christ über sie, sondern er zeigt sie als das, was sie sind: prominente Westberliner, bosnische Serben, polnische Besucher oder arabische Kaffeehausbesitzer. Als Menschen, die ihren Kiez und damit die Stadt in der heutigen Form prägen.
Rolf Edens Cabrio
Meine Füße kochten in der Nachthitze, der Schweiß lief mir von der Stirn aufs Gesicht, doch kein offenes Fenster dieser Stadt half gegen das Gefühl, zwischen hunderttausend Häusern einer von dreieinhalb Millionen zu sein, die alle gleichzeitig von einem Eimer Schnee träumten. Ohne Schlaf.
Dann ging die Sonne auf. Für kurze Zeit schmeckte die Luft nach Pfefferminztee. Es sind jene Stunden, in denen man bei dieser Hitze alle nötigen Entscheidungen des Tages treffen sollte. Später drückt die Luft alle Gedanken platt. Niemals im ganzen Jahr hört man so häufig das pappsatte Maschinenjaulen von Sportwagen und Motorrädern wie an diesen Sommernachmittagen. Es ist, als seien die Fahrer auf der Suche nach einem Echo. Wie Kinder, die mit der Trommel um den Weihnachtsbaum laufen und hämmern, hämmern, hämmern.
Und doch. Am Abend, wenn die Gedanken schon zu Soße verlaufen sind, ist es so einfach wie sonst nie wieder im Jahr, Menschen kennenzulernen. Man trifft sie. Auf der Straße. Selbst da, wo man sie nicht vermutet.
Bei Sonnenuntergang fuhr ich durch Wilmersdorf, den Hohenzollerndamm entlang. Das verschachtelte Leben von früher: Ich sah die Häuser aus Beton und ahnte, dass ihr Design einst modern war. Aber ich fühlte davon nichts mehr, weil ich schon mit anderen Wünschen geboren wurde.
Auch am Ernst-Reuter-Platz geht es mir regelmäßig so oder an der Messe: Radfahren ist dann fast so wie ins Museum zu gehen. Es ist, als hätte sich der alte Westen vor fünfundzwanzig Jahren in der Geschichte verkeilt und seitdem permanent Bremsspuren produziert. Ich höre die Menschen hier reden, sie sprechen ja Deutsch. Aber besonders die Älteren erzählen oft Geschichten, die ich entschlüsseln muss, weil ich die Bezugspunkte nicht verstehe. Ich kenne ihre Helden aus Zeitungen und Büchern. Ich weiß, dass es sie gibt. Das ist alles.
An der Uhlandstraße erwischte ich gerade noch die grüne Ampel. Dann musste ich bremsen.
Von links kam Rolf Eden in seinem Rolls Royce-Cabrio angeschossen. Er war bei rot über die Haltelinie gefahren und achtete weder auf den Kreuzungsbereich noch auf die Ampel. Mich jedoch fixierte er mit Münzschlitzaugen. Seine grauen Haare zappelten in der Abendluft. Er musterte mich, als ob er mich bei der Mafia anschwärzen wollte. Ich hätte noch ein paar Fragen gehabt. Aber er gab dröhnend Gas.
Und das ist es auch, was entscheidend ist: Dass der Wind stets weht und dass all die kleinen Explosionen in den Motorkolben eines Rolls Royce sich kaum anders anhörten als ein ziemlich lautes Selbstgespräch zwischen den bröckelnden Fassaden des alten Westberlins.


